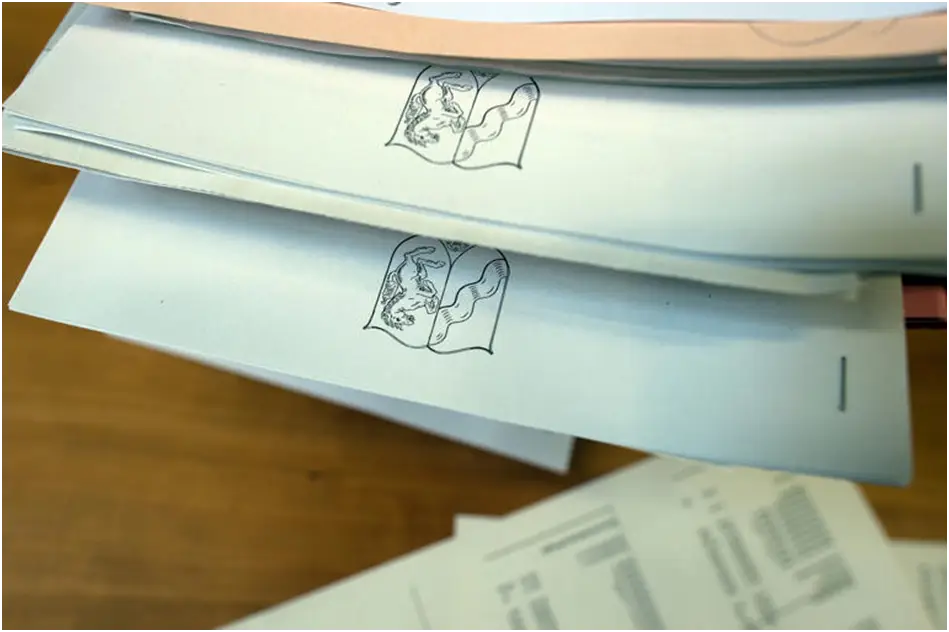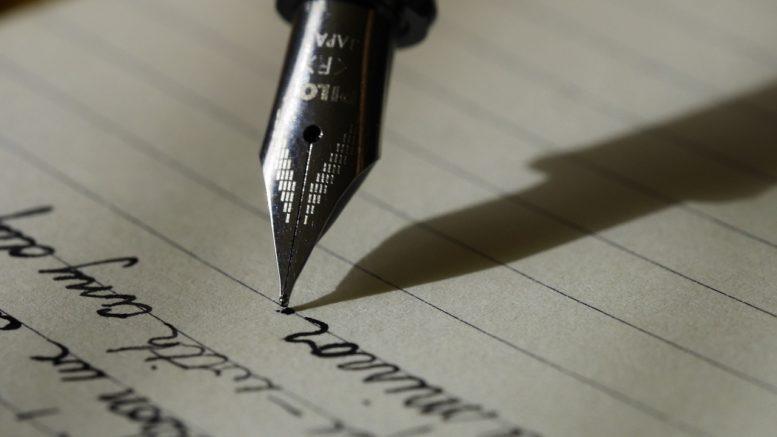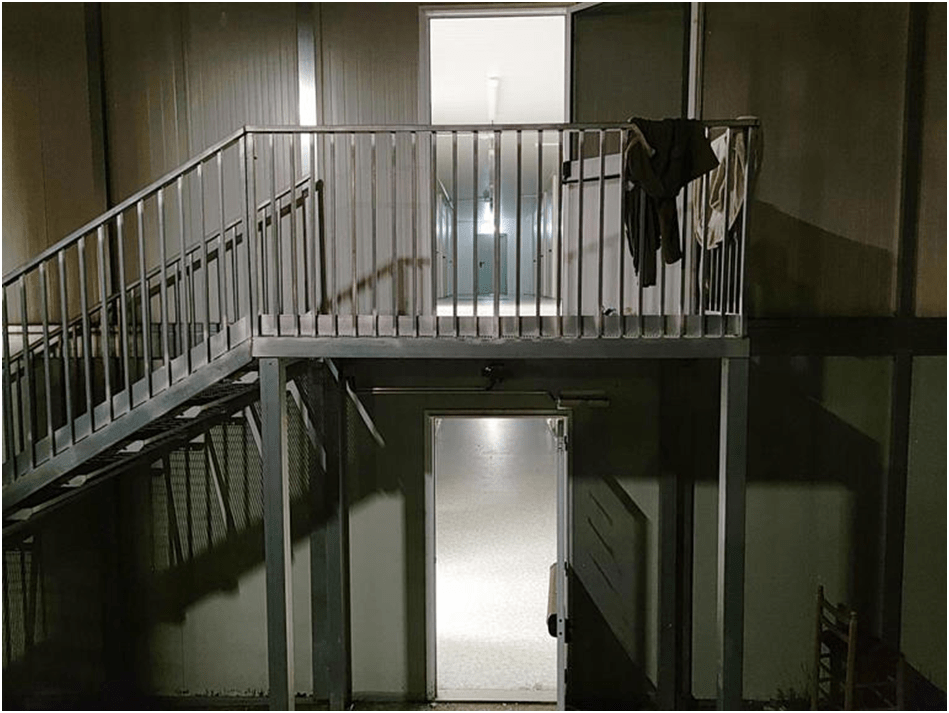Dieses Thema ist seit Jahren ungelöst. Da beide Seiten ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllt haben, hat sich das Problem wie eine sich windende Schlange in die Länge gezogen. Obwohl der Türkei in diesem Prozess große Verantwortung zukam, wurden die zu lösenden Probleme mit einem nationalistischen und rassistischen Ansatz angegangen, weshalb sie bis heute ungelöst geblieben sind.
An vorderster Front dieser Probleme stehen die kurdische und die alevitische Frage. Diese Gruppen waren im Laufe der Geschichte Unterdrückung und Praktiken ausgesetzt, die zeitweise das Ausmaß eines Völkermords erreichten, doch für die Probleme wurde bis heute keine dauerhafte Lösung gefunden. Anstatt sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, leugnet die Türkei weiterhin den Völkermord an den Armeniern und verlegt sich auf die Leugnung der Leugnung, indem sie behauptet, es habe gar keinen Völkermord gegeben.
Die Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union begannen mit dem Abkommen von Ankara, das am 12. September 1963 unterzeichnet und am 1. Dezember 1964 in Kraft trat. Dieses Abkommen begründete eine Assoziation zwischen der Türkei und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das Abkommen sah einen dreistufigen Integrationsprozess vor, der aus einer Vorbereitungsphase, einer Übergangsphase und einer Endphase bestand. In diesem Prozess wurde die Vollendung der Zollunion angestrebt. Mit dem Ende der Vorbereitungsphase legte das am 13. November 1970 unterzeichnete und 1973 in Kraft getretene Zusatzprotokoll die Bedingungen der Übergangsphase und die Verpflichtungen der Parteien fest.
Die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union sind für die Türkei ein vielschichtiger Prozess. Diese Verhandlungen werden unter 35 Kapiteln geführt, die von Wirtschaft und Außenpolitik bis zur Rechtsstaatlichkeit reichen. Die Beitrittskonferenzen zwischen den EU-Ländern und dem Kandidatenland bilden die Grundlage dieses Prozesses. Ziel der Verhandlungen ist, dass das Kandidatenland den EU-Rechtsbestand (Acquis communautaire) vollständig übernimmt.
Der Verhandlungsrahmen für die Türkei enthält nicht nur die Verpflichtungen für eine Vollmitgliedschaft, sondern auch eine „umfassende Klausel“, die die Integration der Türkei in die europäischen Strukturen vorsieht, falls diese Verpflichtungen nicht erfüllt werden können. Zudem gibt es eine Klausel zur Aussetzung der Verhandlungen, falls die Türkei die Grundwerte der EU wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schwerwiegend verletzen sollte.
Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei begannen am 3. Oktober 2005. Seitdem wurden von den 35 Kapiteln jedoch nur 18 eröffnet und lediglich eines konnte abgeschlossen werden. Das letzte Kapitel wurde 2016 eröffnet. Im selben Jahr beschloss das Europäische Parlament aufgrund der politischen Entwicklungen in der Türkei, die Verhandlungen einzufrieren.
Einer der Hauptgründe für die Blockade der Verhandlungen ist die Zypern-Frage. Die Türkei weigert sich, Zypern anzuerkennen, und hat ihre Häfen nicht für Schiffe aus Zypern geöffnet. Dies wurde von der EU kritisiert, und 2006 wurden die Verhandlungen teilweise ausgesetzt. Die Nichtumsetzung des Ankara-Protokolls hat den Fortschritt der Verhandlungen behindert, und dieser Beschluss wird jedes Jahr erneuert.
Auch im Bereich der Menschenrechte wird die Türkei scharf kritisiert. In den Fortschrittsberichten der EU-Kommission werden häufig eine Verlangsamung des Reformprozesses und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei thematisiert. Zu den Hauptkritikpunkten gehören die ausbleibende demokratische Lösung der kurdischen Frage, die Nichterfüllung der Forderungen der alevitischen Gemeinschaft, die Nichtanerkennung des Völkermordes an den Armeniern und die Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Türkei zeigt weiterhin eine widersprüchliche Haltung bei der Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Insbesondere die jüngste Einsetzung von Zwangsverwaltern (Kayyum) in den Rathäusern der kurdischen Provinzen sowie das juristische Vorgehen gegen den Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu und die Verhaftungen in seinem Umfeld haben die Türkei erheblich vom Ziel der EU-Vollmitgliedschaft entfernt und unserer Demokratie großen Schaden zugefügt.
Obwohl seit mehr als einem halben Jahrhundert 7–8 Millionen ihrer Bürger in EU-Ländern leben, hat die Türkei durch das Nichterreichen des Ziels der Vollmitgliedschaft auch die Lösung der Probleme dieser Menschen verzögert.