Türkei: Entspannung gegen Stimmen
Artikel von Gerd Höhler / F.R.
ämpferinnen des militärischen Arms der PKK legen im Irak zeremoniell die Waffen nieder. © Shwan Mohammed/AFP
Das Ende des PKK-Konflikts soll Präsident Erdogan in der Türkei sein Amt erhalten.
Die Türen der großen, mächtigen Türkei sind nun weit geöffnet“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Ankara. Tags zuvor hatten Kämpfer:innen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK symbolisch einige Waffen niedergelegt. Erdogan hofft, dass damit auch für ihn eine Tür aufgeht: die zu seiner Wiederwahl.
Es war ein zeremonieller Akt, der aber einer von historischer Bedeutung sein könnte: Am Freitag legten 30 PKK-Kämpferinnen und -Kämpfer in der Nähe der nordirakischen Stadt Sulaimanijah ihre Waffen nieder. In einer stählernen Feuerschale verbrannten sie Kalaschnikow-Gewehre. 300 von der PKK geladene Gäste verfolgten das Schauspiel. Im Mai war die PKK einem Aufruf ihres seit 1999 inhaftierten Gründers Abdullah Öcalan gefolgt und hatte ihre Auflösung beschlossen. Sie kämpfte anfangs für einen eigenen, marxistisch geprägten Kurdenstaat, später für Selbstverwaltung innerhalb der türkischen Republik. „Wir werden von nun an unseren Kampf für Freiheit, Demokratie und Sozialismus mit politischen und juristischen Mitteln fortsetzen“, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung der PKK.
Vertreter der türkischen und der irakischen Regierung sowie der kurdischen Selbstverwaltung im Nordirak sollen die Entwaffnung der PKK beaufsichtigen, die bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Wie viele Waffen die PKK besitzt und ob sie in den nächsten Monaten tatsächlich alle abgibt oder unbrauchbar macht, dürfte kaum zu überprüfen sein. Aber darauf kommt es letztlich auch gar nicht an: Militärisch ist die PKK durch die ständigen Angriffe der türkischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren ohnehin keine große Gefahr mehr. Auch in der kurdischen Bevölkerung wächst die Forderung nach einer friedlichen Lösung des Konflikts.
Staatschef Erdogan reagierte indessen geradezu euphorisch auf die symbolische Waffenverbrennung: „Mit dem heutigen Tag beginnt das Ende einer 47-jährigen Terrortortur; die Türkei lässt eine Ära der Tränen hinter sich“, sagte er am Samstag auf einer Parteiveranstaltung in Ankara: „Heute beginnt ein neues Kapitel unserer Geschichte!“
Erdogan dürfte darauf hoffen, dass damit auch ein weiteres Kapitel in seiner politischen Laufbahn beginnt. 2028 endet seine Amtszeit. Nach der geltenden Verfassung dürfte er nicht erneut kandidieren. Der Staatschef hat aber kürzlich ein Team handverlesener Juristen mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung beauftragt. Beobachtende vermuten, dass er sich so eine weitere Amtsperiode oder gar das Präsidentenamt auf Lebenszeit sichern will. Für die Verfassungsänderung braucht Erdogan jedoch auch Stimmen aus den Reihen der Opposition. Von der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP, kann Erdogan keine Unterstützung erwarten, nachdem die Justiz in den vergangenen Wochen Dutzende CHP-Politiker angeblich wegen Korruptionsvorwürfen verhaften ließ.
Damit kommt die prokurdische DEM-Partei ins Spiel. Mit ihrer Unterstützung könnte Erdogan die neue Verfassung durchs Parlament bringen. Das neue Grundgesetz könnte im Gegenzug zu der Zustimmung den rund zwölf Millionen Kurdinnen und Kurden die Anerkennung als ethnische Minderheit geben und ihnen mehr politische und kulturelle Rechte sichern.
Die Diskussionen darüber haben bereits begonnen. Am vergangenen Montag empfing Erdogan in seinem Präsidentenpalast die DEM-Politiker Pervin Buldan und Mithat Sancar zu einem vertraulichen Gespräch. Noch im vergangenen Jahr dämonisierte Erdogan DEM-Politiker als Terroristen, jetzt sucht er ihre Unterstützung.
Damit die Rechnung aufgeht, muss Erdogan nun aber konkrete Angebote machen: Welche Rechte soll die Verfassung den Kurd:innen zugestehen? Wird es für die PKK-Kämpfer:innen Straffreiheit und eine Wiedereingliederung in die türkische Gesellschaft geben? Und kommt der seit über 26 Jahren inhaftierte PKK-Chef Öcalan jetzt in Freiheit? Bisher hat die türkische Regierung auf diese Fragen keine Antwort gegeben.




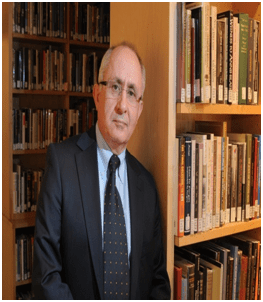
 https://medyascope.tv/
https://medyascope.tv/