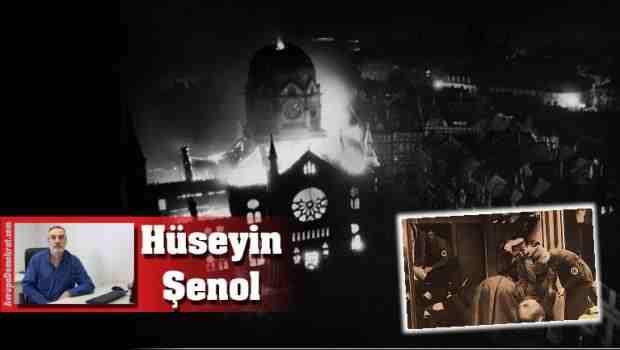Hüseyin Şenol
• Diese Nacht ist die Nacht des Pogroms… 1938 war der Krieg noch nicht erklärt worden. Dieser Mordversuch war auch eine Probe, um das deutsche Volk für den bevorstehenden Krieg zu mobilisieren. Darin waren die Nazis leider erfolgreich…
• Der „Frieden“ muss auch die Pogrome gegen das kurdische Volk und alle anderen Völker und Glaubensrichtungen zur Rechenschaft ziehen…
Die Pogromnacht, die sich vor 87 Jahren in Deutschland ereignete, war der erste Schritt zu einem Völkermord. Aber sie endete nicht dort. Sie dauert heute in unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Zielen, in der Politik der Staaten und im Schweigen der Gesellschaften an.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerbrachen in Nazi-Deutschland nicht nur die Scheiben, sondern auch die Menschlichkeit. Der seit Jahren geschürte Hass gegen das jüdische Volk erreichte in dieser Nacht mit einem organisierten Staatsterror seinen Höhepunkt. Auf direkten Befehl des Gestapo-Chefs Heinrich Müller griffen SS- und SA-Einheiten in Deutschland und Österreich Tausende von Synagogen, Geschäften und jüdischen Häusern an. Mehr als 7.500 Geschäfte wurden geplündert, 267 Synagogen niedergebrannt, 26.000 Menschen in Konzentrationslager deportiert. Allein in dieser Nacht wurden 400 Menschen ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl auf 800.
Die Nazis nannten diese Nacht, inspiriert vom Glitzern der zerbrochenen Scheiben, „Kristallnacht“. Aber diese Benennung war ein Versuch, die begangene Barbarei zu ästhetisieren. Es war eine Form der Beleidigung, der Erniedrigung. Denn es gab keine „kristallene Eleganz“, sondern ein organisiertes Pogrom.
Progressive Kreise in Deutschland gedenken des 9. November 1938 deshalb seit Jahren als „Pogromnacht“. Dies ist die richtige Bezeichnung. Denn ein Pogrom ist nicht nur Gewalt, sondern eine systematische Vernichtungspolitik. Mit dieser Nacht wurde der Prozess der Auslöschung des jüdischen Volkes in Deutschland de facto eingeleitet. Die Wege in die Konzentrationslager erhoben sich aus der Asche dieser Nacht.
Rassismus geschieht nicht über Nacht
Der Boden für die Pogromnacht wurde nicht über Nacht bereitet. Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahr 1933 wurden zunächst die Kommunisten, dann die Sozialdemokraten, gefolgt von Juden, Roma, Behinderten, LGBTI+-Personen und anderen oppositionellen Gruppen ins Visier genommen. Jede unterdrückte Gruppe bereitete durch das Schweigen der anderen den Boden für die nächste.
Der 9. November 1938 war nur ein Glied in dieser Kette der Unterdrückung. Er war zugleich eine Probe für die Vorbereitung des Volkes auf den Krieg. Der Zweite Weltkrieg hatte offiziell noch nicht begonnen, aber die Nazis wollten das Volk durch die Schaffung eines inneren Feindes von einer „Säuberung“ überzeugen. Mit dieser Nacht wurde der Antisemitismus nicht nur zu einer Idee, sondern zu einer Massenbewegung.
Rassismus geschieht nicht über Nacht. Er wird durch die Sprache des Staates, den Diskurs der Medien, die in den Schulen gelehrte Geschichtsschreibung, Polizeigewalt und Gerichtsurteile immer wieder neu produziert. Pogrome entstehen nicht plötzlich; sie sind das Ergebnis jahrelangen Hasses.
Moderne Formen der Pogrome
Wir schreiben das Jahr 2025. 87 Jahre sind vergangen. Sind die Pogrome vorbei?
Nein. Sie haben ihre Form geändert. Sie haben ihre Ziele geändert. Aber derselbe Hass, dieselbe Ausgrenzung, dieselbe Sprache der Gewalt bestehen fort.
In Deutschland erzielt die faschistische Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) heute in vielen Bundesländern über 25 % der Stimmen. Bundesweit und in einigen Regionen ist sie die zweitstärkste Partei. Im Wahlprogramm der AfD finden sich offen rassistische Punkte wie die Abschiebung von Migranten, die Verdrängung des Islam aus dem öffentlichen Raum und die Forderung nach kultureller Assimilation. Die Angriffe auf Synagogen nehmen zu. Jüdische Friedhöfe werden geschändet. Flüchtlingsunterkünfte werden in Brand gesteckt. Und viele dieser Angriffe bleiben ungestraft.
Gleichzeitig wird der Antisemitismus über die Palästina-Frage neu geformt. Selbst wenn die Massaker des israelischen Staates in Gaza kritisiert werden, können Menschen des Antisemitismus beschuldigt werden. So wird der Kampf gegen echten Antisemitismus durch ein Instrument des Mundtotmachens ersetzt.
Die eigentliche Gefahr ist jedoch die Normalisierung des Rassismus. Auf der Straße, in der Schule, an der Universität, im Gesundheitswesen – in allen Bereichen werden migrationsfeindliche Politiken zum Teil des Alltags. Rassistische Netzwerke in der deutschen Polizei und Armee werden aufgedeckt, aber die Akten werden schnell geschlossen. Überall dort, wo der Faschismus einsickert, herrscht Schweigen.
Und dieses Schweigen muss gebrochen werden, nicht nur gegenüber dem Antisemitismus, sondern auch gegenüber dem zionistischen Staatsterror, der heute gegen das palästinensische Volk ausgeübt wird, und der Barbarei islamofaschistischer Bewegungen wie Hamas und Hisbollah, die sich als Reaktion darauf organisieren. Der Kampf gegen Rassismus erfordert nicht nur die Verurteilung der Völkermörder der Vergangenheit, sondern auch der volksfeindlichen Kräfte von heute.
Die Pogrom-Mentalität in der Türkei
Auch in der Türkei ist die Pogrom-Mentalität stark ausgeprägt. Diesmal sind die Ziele nicht Juden, sondern Kurden, Aleviten, Migranten, Oppositionelle.
Die Politik der Zwangsverwaltung (Kayyum) gegen das kurdische Volk, die Usurpation der DEM-Partei-Gemeinden, die Verhaftung von Abgeordneten und die Einschränkung des politischen Raums sind ein direktes Beispiel für ein „politisches Pogrom“. Vorfälle wie Roboski, die Keller von Cizre, Suruç, der Anschlag am Bahnhof von Ankara und der Mord an Hrant Dink sind immer noch nicht aufgeklärt. Denn der Staat selbst ist der Verantwortliche.
Angriffe auf alevitische Dörfer, die Markierung von Häusern und Lynchkampagnen gegen Migranten sind ebenfalls Teil dieser Mentalität. LGBTI+-Personen werden täglich zur Zielscheibe gemacht, Frauen werden unter Druck gesetzt, wenn sie eine andere Rolle als die der „akzeptablen Mutterschaft“ einnehmen.
Diese Welle der Unterdrückung, unterstützt durch die Sprache des Staates, die Schlagzeilen der Medien und die Urteile der Justiz, schafft auch in der Türkei eine Ordnung, die an die Pogromnacht erinnert. Nicht Scheiben, sondern Hoffnungen werden zerbrochen. Nicht Häuser werden niedergebrannt, sondern Leben werden zerstört.
Auch die Schweigenden sind verantwortlich
In der Nazizeit haben Millionen von Menschen ihre Nachbarn nicht verteidigt. Sie schwiegen. Sie sahen weg. Sie ignorierten es. Deshalb war der Holocaust möglich. Deshalb war jeder neue Angriff einfacher als der vorherige.
Auch heute gibt es ein ähnliches Schweigen. Der Lehrer, der schweigt, wenn ein Migrantenkind in der Schule ausgegrenzt wird; der Bürger, der sich von seinem rassistisch angegriffenen Nachbarn abwendet; die Medien, die einen unterdrückten Journalisten im Stich lassen – sie alle sind Teil dieses Systems.
Die Worte von Martin Niemöller sind heute noch gültig:
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;
– ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;
– ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen;
– ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen;
– ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
– gab es keinen mehr, der protestieren konnte…
Schweigen ist der größte Verbündete des Faschismus.
Ein ehrenhafter Frieden ist ohne Aufarbeitung nicht möglich
In diesen Tagen wird von einem neuen Prozess gesprochen, der „Frieden“ genannt wird. Ja, ein ehrenhafter und stolzer Frieden ist die legitimste Forderung der Völker. Aber ohne historische Auseinandersetzung, ohne Aufklärung der Wahrheit, ohne dass die Täter der Leugnungs- und Vernichtungspolitik vor Gericht gestellt werden, wird Frieden nur zu einer stillen Übereinkunft. Ein Frieden, der ohne Rechenschaft geschlossen wird, verwandelt sich in einen „Gehorsamsvertrag“ innerhalb der von den Herrschenden gesetzten Grenzen. Wahrer Frieden kann nur auf einem egalitären Fundament entstehen, das das Gedächtnis, das Leid und den Willen der Völker respektiert.
Der „Frieden“ muss auch die Pogrome gegen das kurdische Volk und alle anderen Völker, Glaubensrichtungen und Teile der Gesellschaft zur Rechenschaft ziehen…
Dennoch werden im Namen der Friedenssuche Rufe nach symbolischen Kompromissen mit faschistischen Traditionen laut. Der Ansatz von Selahattin Demirtaş, der auf einem „Recht der Brüderlichkeit“ basiert, und sein Vorschlag, „die Führer und Kommissionsmitglieder hätten sich vor den Gräbern von Türkeş, Menderes und dem Anıtkabir treffen sollen“, sind in diesem Sinne äußerst problematisch. Blumen auf die Gräber von Nazis zu legen ist dasselbe wie das Mausoleum von Türkeş als Adresse des Friedens darzustellen. Sozialisten besuchen nicht die Gräber von Faschisten, deren Leben aus Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestand. Das Andenken und das Grab von Hitler, Mussolini, Franco und ihrem türkischen Pendant Alparslan Türkeş müssen verflucht werden. Die Orte dieser Mausoleen sollten unbekannt gemacht und es sollte niemals erlaubt werden, sie in Show-Plätze zu verwandeln. Frieden ist nicht möglich, indem man für die Seelen der Mörder betet, sondern durch die Forderung nach Gerechtigkeit für die Opfer.
Sich bei denen zu bedanken, die einen neun Jahre lang gefangen gehalten haben, nur weil sie heute sagen, „er soll freigelassen werden“, und diesen Dank auch noch direkt an eine rassistisch-faschistische Figur wie Bahçeli zu richten, ist ein schwerwiegender Mangel an politischem Bewusstsein. Kritische Solidarität darf nicht beiseitegelegt und das Bewusstsein für Erinnerung und Aufarbeitung nicht verwischt werden. Diese Haltung trägt weder zur Freiheit von Demirtaş bei, noch macht sie den Frieden authentisch.
Die von Demirtaş in seinem letzten Artikel auf t24 verwendete Sprache des „Rechts der Brüderlichkeit“ mag wie ein gut gemeinter Appell erscheinen, ignoriert aber die historische Kontinuität und den kolonialen Charakter des Staates. Die kurdische Frage ist kein „Missverständnis“, sondern ein Problem struktureller Herrschaft. Sie kann nicht nur mit emotionalen Bezügen beschrieben werden. Der Vorschlag, „dass die Brüderlichkeit sprechen soll, nicht die Waffe“, macht den historischen Kontext unsichtbar, warum zur Waffe gegriffen wurde. Dies ist eine gefährliche Form des liberalen Optimismus. Insbesondere wenn diesem Friedensvorschlag das Lob von Ahmet Türk hinzugefügt wird, dass „Erdoğan nach Mustafa Kemal die einflussreichste Persönlichkeit des Staates war“, verwandelt sich der Friedensprozess in eine Grundlage, die nicht den Völkern zugutekommt, sondern die Herrschaft der Herrschenden festigt. Diese Sprache von Ahmet Türk, die ständig faschistische Führer verherrlicht, überschattet den Kampf der Völker. Eine klare Haltung gegen diese Sprache ist für die Ehre des Friedens und das Gedächtnis der Völker unerlässlich.
Aber trotz all dieser Kritik sage ich: Ich bestehe auf Frieden. Ich verteidige den Frieden, indem ich mich von Bestrebungen distanziere, die die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ausschließen, und indem ich die Wahrheit, das Gedächtnis und die Ehre der Völker in den Mittelpunkt stelle. Unsere Solidarität ist kritisch, denn ein wahrer Frieden ist nur durch Aufarbeitung möglich.
Andernfalls wird im Namen des Friedens ständig das Gedächtnis der Völker mit Füßen getreten und der Schatten faschistischer Figuren legitimiert. So betraten die Fußballer beim gestrigen Spiel Amedspor-Hatayspor das Spielfeld mit einem Banner mit der Aufschrift „In Respekt, Sehnsucht und Dankbarkeit für den großen Führer Mustafa Kemal Atatürk“. Wenn „unsere Vorstehenden“ weiterhin völkermörderische, rassistische und faschistische Führer loben, ist es unmöglich, die Wiederholung dieser Mentalität auf der Straße, auf dem Spielfeld und auf den Tribünen zu verhindern.
Solidarität gegen Pogrome
…1938 war der Krieg noch nicht erklärt worden. Dieser Mordversuch war auch eine Probe, um das deutsche Volk für den bevorstehenden Krieg zu mobilisieren. Darin waren die Nazis leider erfolgreich…
Der 9. November ist nicht nur ein Tag der Trauer. Er ist ein Tag des Widerstands, der Solidarität, ein Aufruf zum Kampf. Sich an die Pogromnacht zu erinnern bedeutet, nicht nur die Schande der Vergangenheit zu tragen, sondern auch die Verantwortung der Gegenwart.
Ich grüße diejenigen, die in Berlin Flüchtlingsunterkünfte verteidigen, die internationalistischen Demonstranten gegen die Zwangsverwalter in Istanbul, die Menschen, die in Paris für Palästina auf die Straße gehen, die Frauen, die in Teheran Freiheit fordern, die Mütter, die in Diyarbakır Frieden rufen.
Ich gedenke heute mit Respekt all jenen, die nicht zum Faschismus schweigen, die auf der Straße, in der Fabrik, in der Schule Widerstand leisten. Denn der Kampf gegen den Faschismus ist nicht nur mit Geschichtsbewusstsein, sondern mit Taten möglich.
Die Nacht des Faschismus ist nicht vorbei. Aber der Kampf geht weiter.